Was Sie schon immer (nicht) wissen wollten (16)
Der Stinkefinger
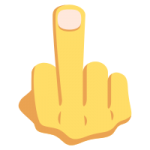 Jede(r) hat ihn schon gesehen, vielleicht sogar schon jemandem gezeigt: den sogenannten Stinkefinger. Die Geste des hochgereckten Mittelfingers bei gleichzeitig eingezogenen anderen Fingern ist bekannt. Doch woher stammt diese Geste eigentlich? Wie sieht es bei deren Verwendung juristisch aus? Der Autor klärt auf und verweist auf ein interessantes Buch zum Thema. Auch hier behandelt: die mit dem Stinkefinger verwandte Feigenhand.
Jede(r) hat ihn schon gesehen, vielleicht sogar schon jemandem gezeigt: den sogenannten Stinkefinger. Die Geste des hochgereckten Mittelfingers bei gleichzeitig eingezogenen anderen Fingern ist bekannt. Doch woher stammt diese Geste eigentlich? Wie sieht es bei deren Verwendung juristisch aus? Der Autor klärt auf und verweist auf ein interessantes Buch zum Thema. Auch hier behandelt: die mit dem Stinkefinger verwandte Feigenhand.
Die Geste
Jede(r) hat ihn schon gesehen, vielleicht sogar jemandem gezeigt. Der Stinkefinger gilt als sehr obszöne und beleidigende Geste. Durch den hochgereckten Mittelfinger bei gleichzeitig eingezogenen anderen Fingern symbolisiert sie einen erigierten Penis mit den Hoden. Damit zeige ich dem anderen, dass ich den größeren und längeren („Schwanz“) habe. Somit ist diese Geste Ausdruck eines Dominanzverhaltens. Nicht nur eines männlichen übrigens, denn er wird ja auch von Frauen gezeigt, wenngleich eher selten.
Bekannte Zeiger des Stinkefingers
Allseits bekannt dürfte noch der damalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg sein. Er zeigte die Geste während eines Spiels der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in Dallas, USA, gegen deutsche Zuschauer. Sie waren mit seiner spielerischen Leistung unzufrieden und äußerten dies durch lautstarke Pfiffe. Er wurde daraufhin aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen. Im März 2015 ist der Stinkefinger des damaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis, den er 2006 Deutschland gezeigt haben soll, in die Schlagzeilen geraten. Doch zu Griechenland später mehr.
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück schließlich zeigte den Stinkefinger 2013 sogar auf der Titelseite der Süddeutschen Zeitung, um damit auf seinen an Pannen reichen Wahlkampf zu reagieren. Die Geste brachte ihm allerdings teilweise auch Sympathien ein.
Die Geschichte des Stinkefingers
Erste literarische Quellen finden sich bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. bei Aristophanes in seiner Komödie „Die Wolken“. Die erste bildliche Darstellung erfolgte im 1. Jahrhundert auf einer römischen Urne, auf der bei zwei Gladiatoren dargestellt wurden, von denen einer außer dem Schwert in der einen noch mit der anderen Hand den Stinkefinger zeigt.
Diese Geste war seltsamerweise über Jahrhunderte fast verschwunden, bis sie im 20. Jahrhundert von Amerika aus, wohin sie möglicherweise italienische Einwanderer brachten, eine steile Renaissance begann. Im ausgehenden 19. Jahrhundert tauchte der Stinkefinger zunächst auf Fotos von Baseball-Mannschaften in den USA wieder auf, in einem Stummfilm von Harry Langdon wurde er filmisch verewigt. Die in Nordkorea gefangen gesetzte US-amerikanische Schiffsbesatzung der „USS Pueblo“ hatte 1968 den in Asien unbekannten Stinkefinger auf Propagandafotos gezeigt. Sie wollten damit den Triumph ihrer Peiniger, die Mannschaft sei übergelaufen, durch dessen Zeigen entlarven.
Juristische Folgen
 Im Straßenverkehr hierzulande drohen beim Zeigen des Stinkefingers zwischen 600 bis zu 4000 Euro Bußgeld, sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr ist möglich! Auch in Brasilien übrigens wird das Zeigen mit drakonischen Strafen belegt, während es beispielsweise in Griechenland eine eher drittklassige Geste darstellt. Vor allem in den USA, dort nur the finger genannt, ist er weit verbreitet und damit quasi funktionslos geworden. In Arabien oder Asien wurde er erst durch die Folgen der Globalisierung bekannt.
Im Straßenverkehr hierzulande drohen beim Zeigen des Stinkefingers zwischen 600 bis zu 4000 Euro Bußgeld, sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr ist möglich! Auch in Brasilien übrigens wird das Zeigen mit drakonischen Strafen belegt, während es beispielsweise in Griechenland eine eher drittklassige Geste darstellt. Vor allem in den USA, dort nur the finger genannt, ist er weit verbreitet und damit quasi funktionslos geworden. In Arabien oder Asien wurde er erst durch die Folgen der Globalisierung bekannt.
Im Zweifelsfall frage, wer den Stinkefinger oft und gern zeigt, vor Reisen ins Ausland explizit nach!
Ein Lesehinweis zum Stinkefinger
Reinhard Krüger, Professor für Romanistik und Gestenforscher an der Universität Stuttgart, hat die Geschichte des Stinkefingers erforscht und ein Buch darüber geschrieben: Der Stinkefinger. Kleine Geschichte einer wirkungsvollen Geste, Berlin 2016. (Siehe hierzu auch die weiteren Verweise unten!)
Der Stinkefinger und die verwandte Feigenhand
 Während der Stinkefinger durchweg als obszöne Geste gilt, wird das Zeigen der Feigenhand sehr unterschiedlich bewertet. Diese Geste der Faust mit dem zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmten Daumen gilt in West- und Mitteleuropa sowie in China als sehr vulgär, weil sie den Geschlechtsverkehr symbolisiert. Dies war jedoch nicht immer und ist überall so.
Während der Stinkefinger durchweg als obszöne Geste gilt, wird das Zeigen der Feigenhand sehr unterschiedlich bewertet. Diese Geste der Faust mit dem zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmten Daumen gilt in West- und Mitteleuropa sowie in China als sehr vulgär, weil sie den Geschlechtsverkehr symbolisiert. Dies war jedoch nicht immer und ist überall so.
Neben dieser Symbolisierung kann die Feigenhand in unserem Kulturkreis im übertragenen Sinn auch ein vulgäres Nein bedeuten, eine Zurückweisung. Damit entspricht sie verbal etwa einem „Fick dich (ins Knie)“ oder, freundlicher ausgedrückt, einem „Vergiss es“. Im antiken Rom jedoch war die Feigenhand ein verbreitetes Fruchtbarkeits- und Glückssymbol und diente als Amulett zur Abwehr von bösem Zauber. Auch bei den Germanen wurde sie als Symbol verwendet.
Feigenhand-Talismane
 Feigenhand-Talismane gelten in Portugal und insbesondere in Brasilien aber auch heute noch als Glücksbringer, wo sie, als figa (Feige) bezeichnet, Glück wünschen sollen, gar Potenz. Sie stehen dort für Fruchtbarkeit, Erotik, für mache repräsentieren sie gar die weiblichen Genitalien. Dass den Feigenhand-Talismanen dort jede anstößige Bedeutung abgeht, beweist die Tatsache, dass sogar Frauen sie tragen und auch an Männer verschenken. So bin ich stolzer Besitzer eines Feigenhand-Anhängers und eines Kugelschreibers mit aus tropischem Holz geschnitztem Feigenhand-Griff.
Feigenhand-Talismane gelten in Portugal und insbesondere in Brasilien aber auch heute noch als Glücksbringer, wo sie, als figa (Feige) bezeichnet, Glück wünschen sollen, gar Potenz. Sie stehen dort für Fruchtbarkeit, Erotik, für mache repräsentieren sie gar die weiblichen Genitalien. Dass den Feigenhand-Talismanen dort jede anstößige Bedeutung abgeht, beweist die Tatsache, dass sogar Frauen sie tragen und auch an Männer verschenken. So bin ich stolzer Besitzer eines Feigenhand-Anhängers und eines Kugelschreibers mit aus tropischem Holz geschnitztem Feigenhand-Griff.
Aber selbst wenn sogar der von mir hoch geschätzte Forscher auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur, Universitätsprofessor und Gründer des Instituts für Kinder- und Jugendliteratur Klaus Doderer, eine große, aus Holz geschnitzte Feigenhand auf seinem Schreibtisch im Institut stehen hatte, verbietet es sich allerdings hierzulande, als Frau eine figa zu tragen. Die für hiesige Männer doch sehr missverständliche Aussage könnte zu unerwünschten Belästigungen führen.
Weitere Verweise
- Deutschlandradio Kultur: „Kulturgeschichte des Stinkefingers — ‚Was Schlimmes, Aggressives, Sexuelles‘“, Reinhard Krüger im Gespräch mit Ute Welty vom 9. April 2016
- Handelsblatt: „Varoufakis-Eklat — Kulturgeschichte des Stinkefingers“ vom 16. März 2015
- Matriarchat.info: „Herzform als Symbol der Feige“ von Hannelore Vonier über die Feige und die Feigenhand
- Ronalds Notizen: „Erotik und Finger hinein“, „Was Sie schon immer (nicht) wissen wollten (7)“ über die Herkunft von „Digital“, „Was Sie schon immer (nicht) wissen wollten (3)“ über das Essen mit den Fingern in Thailand und „Das Aktbild“ über das Malen eines Aktbildes mit den Fingern
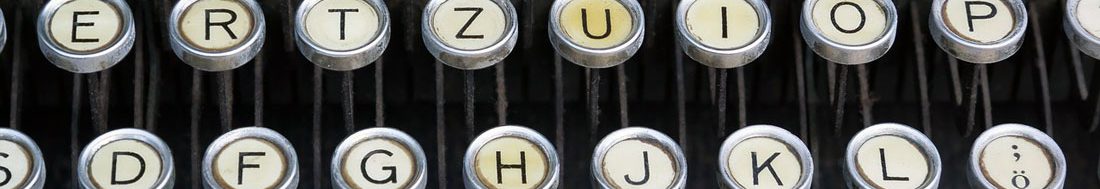

Pingback:Die Rüpel sind immer die anderen! – Ronalds Notizen
Pingback:Sticker gegen die AfD – Ronalds Notizen